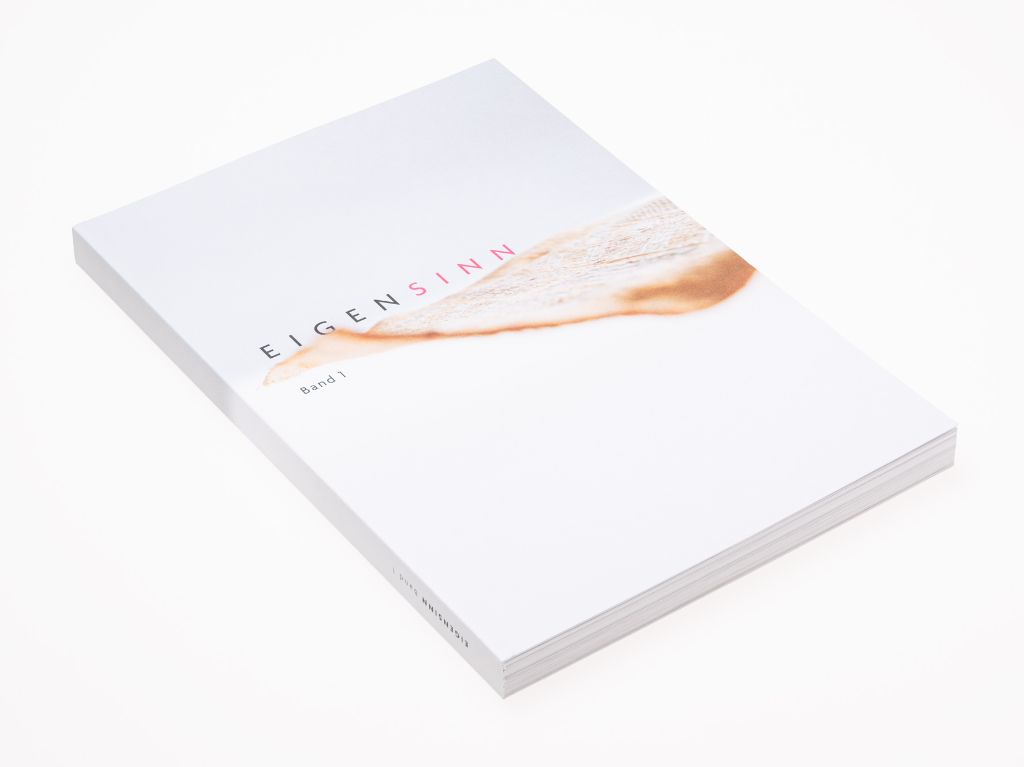Forschung
Basis für die museale Arbeit ist die Forschung. Sie macht das Bewahren, Ausstellen und Vermitteln erst möglich. Durch sie werden neue Ideen und Perspektiven generiert. Forschung garantiert Reflexion und Selbstreflexion – (nicht nur) in der Ethnologie ein Muss. Deshalb finden laufend Forschungsprojekte zu einzelnen Objekten oder ganzen Konvoluten der Sammlung statt.
Forschung setzt sich fundiert mit der Sammlung und der Geschichte des Museum der Kulturen Basel (MKB) auseinander. Interne sowie externe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erforschen die Bedeutung von Objekten. Sie befassen sich mit Sammlungspraktiken und den Netzwerken der Personen, die am Sammeln beteiligt waren. Zudem untersuchen sie die Bedeutung des Museums für die Gesellschaft seit der Gründung. Ohne Forschung wären die anderen Museumsaufgaben wie das Bewahren, Ausstellen und Vermitteln nicht realisierbar.
Fellowship MKB
Mit dem «Georges und Mirjam Kinzel-Fonds» kann das MKB kleine Forschungsprojekte selbst finanzieren. Sie werden im Rahmen des Fellowships MKB durchgeführt. Darüber hinaus gibt es Forschungskooperationen mit anderen Museen, Universitäten und weiteren Institutionen.
Provenienzforschung
Provenienzforschung, das heisst Erforschung der Herkunft von Objekten, hat das MKB schon immer betrieben. Sie ist ein zentraler Bereich im Aufgabenspektrum eines ethnologischen Museums.
In den letzten Jahren hat die ethnologische Provenienzforschung weltweit Aufmerksamkeit erregt. Die Politik und Stiftungen haben den Handlungsbedarf erkannt und Ressourcen dafür gesprochen.
Die grundlegende Provenienzforschung am MKB wurde mit Unterstützung vom Bundesamt für Kultur (BAK), des Kantons Basel-Stadt (Mittel aus der Rahmenausgabebewilligung, RAB), der Stiftung zur Förderung des MKB, des Georges und Mirjam Kinzel-Fonds und nicht zuletzt durch einen grosszügigen Beitrag von der Ernst Göhner Stiftung ermöglicht. Die weitsichtig zur Verfügung gestellten Finanzmittel erlauben nicht nur die Aufarbeitung der Sammlungsgenese, sie führen auch zu äusserst reichhaltigen Kooperationen und einer inhaltlichen Neubewertung der Sammlungen.
Forschung zugänglich machen
Und das MKB macht sie auch dem Publikum zugänglich: Unter dem Titel «Vor aller Augen» wurde im Hedi Keller-Saal in den Jahren 2024 und 2025 regelmässig live an Forschungs- und Restitutionsprojekten gearbeitet. Auf diese Weise erhielten die Besucher*innen einen einmaligen Einblick, wurden auf den laufenden Stand gebracht und konnten mit den MKB-Mitarbeitenden direkt in einen Dialog treten.
Darüber hinaus ist der wissenschaftliche Austausch auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene für die Forschung an Sammlungsbeständen wichtig. Mit Kolleginnen und Kollegen der Okinawa Prefectural University of Arts erforscht Stephanie Lovász, Kuratorin Süd-, Zentral- und Ostasien, zum Beispiel die japanische Textilsammlung des MKB. Diese umfasst über 4000 Objekte. Davon konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bis dato rund 200 Objekte der Region Ryūkyū – diese entspricht in etwa der heutigen Präfektur Okinawa – zuordnen. Das Projekt wird vom Hedi Keller-Fonds unterstützt.
Über Gastbesuche berichtet das MKB im Blog und es macht aktuelle Forschungen auch in Ausstellungen zugänglich. Mehr dazu hier.